
Am 18. August 2020 haben das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW Berlin und der Berliner Verein Mein Grundeinkommen gegenüber der Presse den Start einer wissenschaftlichen Studie des DIW zur Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) in Kooperation mit weiteren Partnerinstitutionen bekannt gegeben und über das Forschungsvorhaben informiert. >Presseerklärung des DIW – Link2

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin
Flankiert wurde diese Ankündigung durch den Präsidenten des DIW, dem öffentlichkeitsbekannten Ökonomen Marcel Fratzscher, der seine frühere Ablehnung der Grundeinkommensidee vor Kurzem überwunden und in aufgeschlossene Offenheit transformiert hat. >Link1 – >Link2 – >Link3 – >Link4
Die Ankündigung der DIW-Studie hat (nicht nur) in Deutschland große Resonanz gefunden und könnte hierzulande den Auftakt für eine breitere wissenschaftliche Auseinandersetzung bilden. So sammelt seit einigen Monaten auch die Initiative Expedition Grundeinkommen in verschiedenen Bundesländern Unterschriften für eine Volksabstimmung, nicht direkt über die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, sondern über die Durchführung von staatlich finanzierten „Grundeinkommens-Experimenten“ mit wissenschaftlicher Begleitforschung. An der Freiburger Universität wurde mit Spendengeldern des dm-Drogerieunternehmers Götz W. Werner, der sich seit Jahren für ein BGE einsetzt, das erste Forschungsinstitut zum Grundeinkommen an einer deutschen Hochschule gegründet. Von München aus arbeitet seit 2017 die Stiftung Grundeinkommen an einer Förderung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem BGE. Auch weltweit artikuliert sich aus der Bürgerschaft immer deutlicher ein Drang zur praktischen Erprobung unter Beteiligung der Wissenschaft. >Link
Wirft man einen historischen Blick auf die Grundeinkommensdebatte und auf entsprechende Experimente mit wissenschaftlicher Begleitung, wird bei der neueren Entwicklung eine grundlegende Veränderung deutlich.
1.) Ursprünglich waren öffentliche Diskussionen zum BGE von einem akuten gesellschaftlichen Problemdruck abhängig, der als Aufhänger und Triebfeder der Diskussion fungierte. Dessen Nachlassen oder Verschwinden brachte die Debatte in der Regel wieder zum Erliegen. Seit einigen Jahren scheint sich die Diskussion jedoch von solchen extrinsischen Antriebsfedern weitgehend emanzipiert zu haben und grundsätzlicher geführt zu werden, zum Leidwesen einiger BGE-Gegner*innen, die sich von der anscheinend nicht mehr enden wollenden Diskussion bereits erheblich genervt zeigten. Äußerliche Anlässe behalten weiterhin ihren Einfluss und können Sub-Konjunkturen mit eigenem thematischem Akzent erzeugen. Aber die generelle Debatte zum BGE ist davon allem Anschein nach nicht mehr abhängig und wird mit großer Kontinuität geführt.
2.) In der ersten Phase von BGE-Sozialexperimenten in den 1960er- und 1970er-Jahren in den USA und in Kanada waren es überwiegend intellektuelle, wissenschaftliche, bürgerrechtliche und politische „Führungspersönlichkeiten“, welche die parteiübergreifend geführte Debatte dominierten sowie Fachleute in staatlichen Stellen, die in einem bis heute unübertroffenen Ausmaß die Idee eines BGEs (wenn auch in der Variante einer Negativen Einkommensteuer) in einer ganzen Serie von groß angelegten Pilotstudien in verschiedenen Regionen gewissermaßen „elitär“ bzw. „top-down“ wissenschaftlich-systematisch zu erforschen suchten, mit Laufzeiten von zum Teil bis zu 10 Jahren (Seattle) und Tausenden von Studienteilnehmer*innen (Widerquist 2018: 48). >Link1 – >Link2
Am Ende scheiterte die Implementation des BGEs vor allem an dieser elitären Form der Debatte bzw. daran, dass die große Mehrheit der Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt noch weitgehend ungebrochen den tradierten arbeitsethischen Grundhaltungen anhing und ein BGE vor diesem Hintergrund noch nicht „denken“ konnte, sodass die konservative Nixon-Administration, die das Vorhaben von den vorhergehenden Johnson- und Kennedy-Regierungen übernommen hatte und ohnehin nicht mehr sonderlich offensiv vertrat, das Vorhaben opportunistisch fallen lassen musste (vgl. Steensland 2009). Heute sieht die Situation deutlich anders aus. Die herrschende Politik hat die Grundeinkommensdebatte, die vor allem von engagierten Bürger*innen getragen und vorangetrieben wird (dabei durch eine Reihe von intellektuellen Stimmen und Fachleuten inhaltlich unterstützt und angeregt), lange Zeit mehrheitskonformistisch zu ignorieren versucht und reflexhaft mit wenig sachlichen Pseudo-Argumenten abgewehrt (Stichwort: „kulturelle Abwehrformationen“, vgl. dazu Franzmann 2010), wohl wissend, dass die Idee eines BGEs (derzeit noch) nicht mehrheitsfähig und auch konzeptionell noch nicht genügend geklärt ist.
Dementsprechend zeichnet sich die Situation seit Jahren dadurch aus, dass ein zum Teil diskussionsrenitenter und in jedem Fall mehrheitskonformistischer Politik- und Medien-„Mainstream“ unter seiner offiziellen, staatstragenden Mehrheitskonsens-Oberfläche von immer breiter werdenden Diskussionen zum BGE innerhalb der Bürgerschaft sozusagen unterspült wird. Ähnlich verhielt es sich übrigens auch schon mit den christlichen Ideen im Römischen Reich, das erst zu einem Zeitpunkt das Christentum unter Kaiser Konstantin zur Staatsreligion erhob, als die Bevölkerung schon in großer Mehrheit dem Christentum zugeneigt war. >Link
Vor dem Hintergrund dieser „Unterspülungslogik“ wird verständlich, warum es beim BGE zwar in den letzten Jahren auch staatlich finanzierte Sozialexperimente gegeben hat, zum Beispiel in Finnland oder im kanadischen Bundesstaat Ontario. Aber die große Mehrheit dieser Experimente wird, das ist kaum zu verkennen, graswurzelartig von der Bürgerschaft, von Kommunen oder nicht-staatlichen Akteuren initiiert, finanziert und durchgeführt, sozusagen „bottom-up“. Gerade die genannten Beispiele staatlich finanzierter Grundeinkommensexperimente der Gegenwart zeigen eindrücklich, dass die heute deutlich weniger elitär als noch in den 1960er-Jahren operierende, aber zugleich auch „populistischere“ und schnelllebig-sprunghaftere Dynamik von Regierungspolitik derzeit kaum die Stabilität bietet, um eine längerfristige, staatlich finanzierte Grundeinkommensstudie durchzuführen. So hat die finnische Regierung, die das dortige Grundeinkommensexperiment mit einer Laufzeit von zwei Jahren auf den Weg gebracht hat, schon während des Experiments, nach nur einem Jahr und noch bevor irgendwelche Zwischenergebnisse vorlagen, das Interesse am BGE wieder vollständig verloren und sich politisch anders ausgerichtet, ohne zumindest noch ein Jahr abzuwarten, was bei der Studie wissenschaftlich herauskommt. Im kanadischen Bundesstaat Ontario wurde das auf mehrere Jahre staatlicherseits auf den Weg gebrachte Grundeinkommensexperiment nach einem baldigen Regierungswechsel nach nur einem Jahr trotz der auf mehrere Jahre gegenüber den BGE-Empfänger*innen gemachten Zusagen sogar ganz abgebrochen und jeglicher Vertrauensschutz in den Wind geschlagen.

Die größten Anstrengungen unternimmt derzeit die private Entwicklungshilfeorganisation givedirectly, die in mehreren Studien direkte Geldzahlungen an Arme als Form der Entwicklungshilfe erforscht und bei einer großen Untersuchung ein BGE an über 2000 Haushalte (!) in 44 Dörfern in Kenia über einen Zeitraum von 12 Jahren auszahlt, unter Beteiligung der Wirtschaftsnobelpreisträger von 2019 (die zu der „Randomista“ genannten Gruppe von Wissenschaftler*innen gehören, welche auf „evidenzbasierte“ Politikforschung nach dem Modell von randomisierten kontrollierten Studien großen Wert legt). Zusammen mit den Dörfern einer Kontrollgruppe und Dörfern, in denen das BGE kürzere Zeit ausgezahlt wird, sind bei der Untersuchung insgesamt 295 Dörfer mit 14.474 Haushalten (!) involviert. >Link
Auch die angekündigte DIW-Studie zum BGE ist über Graswurzelaktivitäten engagierter Bürger*innen, organisiert im Verein „Mein Grundeinkommen“, zustande gekommen, dessen beachtliche Crowd-Funding-Bemühungen einen Teil der Finanzierung stemmen. Das DIW soll nun einen institutionell unabhängigen, professionell-wissenschaftlichen Blick auf die Wirkungen einer bedingungslosen Geldzahlung werfen und die bisher gesammelten praktischen Erfahrungen von Grundeinkommenslotteriegewinner*innen (siehe dazu Bohmeyer und Cornelsen 2020) wissenschaftlich-professionell erweitern. Das Geschick, mit der die DIW-Studie öffentlichkeitswirksam bekannt gemacht wurde, sowie die große Resonanz, auf die sie dabei gestoßen ist, deuten darauf hin, dass die Studie wohl in den nächsten Jahren für viele Anlässe zur Berichterstattung und Diskussion über die Idee eines BGEs sorgen wird. Insoweit ist die Entwicklung aus der Sicht von Personen, die sich für das BGE interessieren oder es befürworten, in erster Linie nur zu begrüßen.
Allerdings hat sich in kürzester Zeit auch schon eine erste kritische Diskussion ergeben, die den Leiter der wissenschaftlichen Studie Jürgen Schupp, der an der FU-Berlin eine Professur für Soziologie mit dem Schwerpunkt „Empirische Sozialforschung“ innehat, schon wenige nach Tage nach der offiziellen Ankündigung gegenüber der Presse zu einer öffentlichen Reaktion veranlasst hat. >Link
Es sei an dieser Stelle kurz, auch im Hinblick auf das später Ausgeführte, vermerkt, dass der Ausdruck „Empirische Sozialforschung“ schon seit den 1960er-Jahren mit dem Argument kritisiert wird, dass der Begriff „Forschung“ eigentlich schon per se eine Ausrichtung auf Empirie impliziert und die Bezeichnung „Empirische Sozialforschung“ insofern ein Pleonasmus ist, sozusagen ein weißer Schimmel, der von Vertretern der quantifizierenden Sozialforschung in den Nachkriegsjahrzehnten exklusiv-anmaßend für das eigene, mathematisch-statistische Vorgehen verwendet worden ist, so als seien allein statistische Methoden „empirische“ und gäbe es auch eine „nicht-empirische“ Forschung. Tatsächlich hat sich dieser fragwürdige Wortgebrauch bis heute ein Stück weit erhalten, denn unter „empirischer Sozialforschung“, „empirischer Bildungsforschung“ usw. wird selbst heute noch überwiegend eine Forschung auf Grundlage von statistischen Zahlen verstanden, wenn auch nicht mehr so exklusiv wie früher. Anachronistisch mutet dieser Wortgebrauch nicht nur deswegen an, weil fallrekonstruktive wie auch quantifizierende (und als solche zwangsläufig subsumtionslogisch-voreingenommene) Forschungsmethoden gleichermaßen ihre Berechtigung haben. Es ist faktisch auch so, dass mit ersterer eindeutig die begrifflich sehr viel präzisere (und damit zusammenhängend auch unvoreingenommenere) Strukturerkenntnis möglich ist und angesichts dessen die sachliche Legitimation eines Einsatzes von quantifizierenden Methoden daran hängt, dass es für den dabei erlittenen Verlust an begrifflich-strukturanalytischer Präzision nachvollziehbare, gute Gründe gibt, in deren Lichte die statische Erhebung von Häufigkeitsverteilungen von selektiv-bestimmten Merkmalsdimensionen wichtig erscheint.
Jürgen Schupp geht in seiner ersten Reaktion auf Kritik im FAZ-Blog vor allem auf drei Fragen ein, die anscheinend seiner Wahrnehmung nach die drei wesentlichsten in der kritischen Diskussion sind.
- Ist die Stichprobe zu klein?
- Läuft das Experiment zu kurz?
- Kann das Grundeinkommen schaden? [Diese Frage werde ich im Folgenden auslassen.]
Bei der ersten Frage räumt er ein, dass die Stichprobe aus wahrscheinlichkeitstheoretisch-statistischer Sicht klein ist. Er stellt dem gegenüber, dass sie keineswegs zu klein sei, sondern lediglich die Ansprüche an eine statistische Signifikanz heraufschraube:
„Wir werden unsere Forschungshypothesen mit unserer vergleichsweise kleinen – aber für wissenschaftliche Feldexperimente keineswegs zu kleinen – Stichprobe selbstverständlich mit dem konkreten Start des Experiments innerhalb der scientific community transparent machen und wie dies mittlerweile in der Forschung üblich ist prä-registrieren.“ >Link
Diese Argumentation ist in meinen Augen grundsätzlich überzeugend. Es wäre sicherlich überzogen, der DIW-Studie jeden wissenschaftlichen Wert mit Verweis auf die eher geringe Größe der Stichprobe abzusprechen.
Die zweite Frage „Läuft das Experiment zu kurz?“ wird von Schupp ebenso wie die erste verneint, was der Sache nach nachvollziehbar ist, weil auch diese Entweder-Oder-Frage nüchtern betrachtet zu absolut gestellt wird, was genauso für die erste Frage gilt. Wird hier, so drängt sich angesichts dessen allerdings als Frage auf, ein Pappkamerad konstruiert, der später mit Leichtigkeit zu Fall gebracht werden kann? Die kritische Diskussion zur DIW-Studie lässt sich jedenfalls sicherlich nicht auf diese überspitzten, verabsolutierenden Fragen reduzieren, durch die ernsthaftere kritische Einwendungen aus dem Fokus geraten und Schupps Erwiderung faktisch von Anfang an zum Heimspiel wird.
Dabei hat die ankündigende, erste Presseerklärung zur DIW-Studie kritische Diskussionen zur Größe der Stichprobe und zur Laufzeit der DIW-Studie selbst geradezu heraufbeschworen, weil Schupp die Studie darin als groß angelegte Langzeitstudie angepriesen hat. Wie er in seiner späteren Reaktion auf die daraufhin anhebende kritische Diskussion selbst einräumt, ist die Stichprobe jedoch im Vergleich sehr klein, wenn auch nicht so klein, dass statistische Schlussfolgerungen unmöglich scheinen. Schupp hält allerdings in dem FAZ-Blog und einem weiteren Artikel für den Makronom-Blog (mittlerweile gibt es noch weitere Stellungnahmen) allem Anschein nach weiterhin daran fest, von einer „Langzeitstudie“ zu sprechen. Das wirft die Frage nach dem Maßstab für diese Charakterisierung auf. Hier gibt es mindestens zwei mögliche Betrachtungsweisen.
1.) Eine erste, relative, d. h. eine vergleichende im Hinblick auf schon durchgeführte BGE-Experimente. Bei einem solchen Vergleich erscheint die DIW-Studie zwar nicht als die kürzeste. So gibt es Studien, bei denen nur ein Jahr lang ein BGE gezahlt wurde. Die finnische Studie, auf die sich Schupp selbst bezieht, dauerte zwei Jahre. Die DIW-Studie soll drei Jahre umfassen. Berechtigt diese nur wenige Jahre längere Dauer tatsächlich schon zu der Rede von einer Langzeitstudie? Immerhin gab es schon BGE-Pilot-Studien mit erheblich längeren Laufzeiten, wie schon erwähnt z. B. in den 1970er-Jahren in Nordamerika mit einer ganzen Serie von groß angelegten „Minimum Income Maintenance Experiments“ zur Idee eines „Guaranteed Income“ in verschiedenen Regionen der USA und Kanadas mit einer Laufzeit von teilweise sogar bis zu 10 Jahren (>Seattle/Denver Studie), mit tausenden von Teilnehmer*innen. In der Gegenwart setzt zudem die bereits erwähnte Studie von givedirectly neue Größenmaßstäbe, bei der ein BGE wie gesagt an über 2000 Haushalte (!) in 44 Dörfern im ländlichen Kenia über einen Zeitraum von 12 Jahren auszahlt wird nach dem Modell von randomisierten kontrollierten Studien. Das ist eine Hausnummer, die sicherlich schon eher zu der Rede von einer groß angelegten Langzeitstudie berechtigt, zumindest relativ betrachtet.
2.) Eine zweite, sachliche Betrachtungsweise lässt die relationale Vergleichsperspektive mit bisherigen BGE-Sozialexperimenten außen vor und bemisst die Berechtigung des Wortes „Langzeitstudie“ an den sachlichen Gegebenheiten, um die es geht. Diese Perspektive lässt einen noch deutlich vorsichtigeren Umgang mit dem Ausdruck geboten erscheinen. Niemand würde z. B. auf die Idee kommen, eine gesundheitliche Studie zu den Wirkungen des Rauchens mit einer Laufzeit von drei Jahren als Langzeitstudie zu bezeichnen. Selbst eine 10- oder 12-jährige Laufzeit würde hier nicht unbedingt als sehr lang eingeschätzt werden können. Verhält es sich bei einem BGE womöglich anders, weil es sich um einen anderen Forschungsgegenstand handelt, der sachlich andere zeitliche Maßstäbe setzt? Wohl kaum. Es ist z. B. durchaus ein berechtigter (wenn auch in seinen weiteren Schlussfolgerungen oft überzogen vorgetragener) Hinweis von Kritiker*innen der finnischen BGE-Studie, dass sich ein befürchteter längerfristiger Rückgang der „Arbeitsbereitschaft“ bei BGE-Empfänger*innen bei einer Laufzeit von nur zwei Jahren mit den dabei erhobenen statistischen Daten nicht widerlegen lässt. Tatsächlich hat jede*r BGE-Empfänger*in bei einer solchen Laufzeit Grund in Rechnung zu stellen, dass es sich bloß um eine Experimentalstudie mit begrenzter Laufzeit handelt, bei der nach zwei bzw. drei Jahren wieder die alte, aktivierende Förderpraxis wie bei Hartz IV greift. Bei dieser Aussicht wäre es sehr riskant, eine Arbeitsstelle aufzugeben, die einen später vor der dann erneut drohenden Arbeitslosigkeitsstigmatisierung schützt. Das wäre nur dann rational, wenn man gute Aussichten auf eine erfolgreiche berufliche Transformation innerhalb der recht begrenzten Laufzeit hat. Die veränderte Lebenssituation, deren Wirkung auf Menschen statistisch erforscht werden soll, bleibt also trotz der Bedingungslosigkeit der Zahlung angesichts der Künstlichkeit der Rahmensituation eines Sozialexperiments und der begrenzten Laufzeit sinnstrukturell eine sehr viel restriktivere als diejenige, die schlussendlich interessiert: die dauerhafte Verfügung aller Bürger*innen eines Gemeinwesens über ein BGE. Daher sollte man auch ein Studiendesign, wie das der DIW-Studie, in seinem wissenschaftlichen Wert nicht überschätzen. Was die Wirkung einer verlässlichen, lebensabsichernden Dauerzahlung ohne Bedingungen anbelangt, sind zudem bereits existierende Lebenslagen, in denen Menschen zum Beispiel für den Rest ihres Lebens eine abgesicherte steuerfreie Dauerrente erhalten oder Vergleichbares, bei der sie durch Erwerbsarbeit Geld hinzuverdienen können, nicht weniger aufschlussreich!
Auch Jürgen Schupp kommt in dem zitierten FAZ-Blogartikel unter der Überschrift „Läuft das Experiment zu kurz?“ auf die pharmazeutische Wirkungsforschung zu sprechen, die er zum Vergleich heranzieht. Jedoch tut er dies argumentativ auf eine Weise, die problematisch ist und in meinen Augen ein fragwürdiges Wissenschaftsverständnis offenbart:
„Kann nun ein auf drei Jahr befristetes Projekt überhaupt die Frage beantworten, ob die zentrale Frage, ob nicht doch langfristige ‚unbeabsichtigte Nebenwirkungen‘ im Verhalten auftreten? [sic!] Dies ist selbstverständlich nicht auszuschließen. Aber wie auch bei Zulassungen von Medikamenten bei pharmazeutischen Wirkungsstudien kann nicht grundsätzlich – aber in der Regel mit sinkender Wahrscheinlichkeit – ausgeschlossen werden, dass es auch nach Abschluss einer Zulassung dennoch zu bis dahin nicht beobachteten Nebenwirkungen im weiteren Verlauf kommen kann.“ >Link
Offensichtlich ist bei diesem Textausschnitt im ersten Satz bei dessen Revision ein älteres Satzfragment stehen geblieben. Inhaltlich ist vor allem der Vergleich mit der pharmazeutischen Wirkungsforschung, bei der das Wort „Langzeitstudie“ wie oben ausgeführt in der Regel eine sehr viel längere Laufzeit implizierte, problematisch. Zwar ist der Hinweis darauf, dass sich dort oft schon nach drei Jahren mit einer nennenswerten Wahrscheinlichkeit erkennen lässt, ob die Verabreichung eines Medikaments unmittelbar negative oder positive Wirkungen entfaltet, für sich genommen plausibel und kaum anzuzweifeln, obgleich Langzeitfolgen damit noch nicht erfasst werden. Aber ein entscheidender, fundamentaler Unterschied zwischen der pharmazeutischen Wirkungsforschung und der sozialwissenschaftlichen DIW-Studie zum BGE wird durch den Vergleich bezeichnenderweise folgenreich verdeckt:
Letztere richtet sich auf die sinnstrukturierte Ebene menschlicher Lebenspraxis. Die pharmazeutische Wirkungsforschung bezieht sich dagegen naturwissenschaftlich-stochastisch primär auf die Ebene physikalisch-chemisch-biologischer Wirkungsmechanismen. Warum ist das für den vorliegenden Zusammenhang eine wichtige Differenz? Wenn man bei der pharmazeutischen Wirkungsforschung einen Wirkstoff verabreicht und dessen Wirkung naturwissenschaftlich mit einer Kontrollgruppe aus „statistischen Zwillingen“ vergleicht, erscheint die Gabe des Wirkstoffes tatsächlich als ein statistisch isolierbarer Vorgang, dessen naturwissenschaftliche Wirkung auf kontrollierte Weise nachverfolgt und nachgewiesen werden kann. Die menschliche Lebenspraxis ist jedoch eine sinnstrukturierte und in sich reflexiv. Auf die Studienteilnehmer*innen wirkt daher nicht bloß die BGE-Gabe als isolierbarer Unterschied zur Kontrollgruppe ein, sondern genauso der Umstand, dass diese Gabe mit der beschränkten Perspektive von nur drei Jahren erfolgt. Bei der pharmazeutischen Wirkungsforschung spielt diese Perspektivität der Laufzeit keine Rolle, weil der untersuchte Wirkungsmechanismus der interessierenden Gabe ein naturwissenschaftlicher ist. Auf die reflexivitätsbegabten Empfänger*innen eines BGEs wirkt jedoch diese Perspektivität bei ihrer biografischen Lebensgestaltung von Anfang an direkt ein und verändert ihre Lebenssituation grundlegend. Man kann dies auch so formulieren, dass die Praxiskonstellation der Experimentalstudie in ihrer objektiven Sinnstrukturiertheit, die auf reflexivitätsbegabte, sinnrekonstruierende und -sinngebende Menschen als eine Empirie sui generis einwirkt, eine deutlich andere ist, als die schlussendlich interessierende Situation eines Gemeinwesens, das dauerhaft und für Alle ein BGE eingeführt hat. Dementsprechend lässt sich bei der DIW-Studie die bedingungslose Geldgabe auch nicht in Analogie zu der stofflichen Medikamentengabe bei einer pharmazeutischen Wirkungsforschung als isolierter Akt der experimentellen Einwirkung begreifen und darauf dann alle statistisch identifizierbaren Folgewirkungen, die im Kontrast zu einer parallel beobachteten Kontrollgruppe auftreten, ursächlich beziehen, sondern man muss von vornherein die gesamte, künstlich erzeugte Praxiskonstellation der Experimentalstudie als analytischen Ausgangspunkt der experimentellen Einwirkung auf die Studienteilnehmer*innen begreifen und die statistisch identifizierbaren Folgewirkungen auf dieses spezifische „Gesamtpaket“ beziehen.
Dazu gehört, über die Gabe der BGE-Zahlung und die begrenzte Laufzeitperspektive hinaus, auch die Tatsache, dass diese Gabe im Kontext einer besonderen Experimentalstudie in einem sehr spezifischen politisch-gesellschaftlichen Umfeld „verabreicht“ wird, was ebenfalls direkt auf die Studienteilnehmer*innen einwirkt, die im Kontrast zur Kontrollgruppe wissen, dass sie mit ihrem Verhalten den weiteren Gang der BGE-Debatte beeinflussen werden. Bei der naturwissenschaftlichen Wirkungsforschung spielen solche sinnstrukturierten Praxiskonstellationen, Kontexte und Perspektiven erst einmal keine Rolle. In den Sozialwissenschaften gehören sie konstitutiv dazu.

Schon bei der zweijährigen Grundeinkommensstudie in den Dörfern Otjivero und Omitara in Namibia (2008-09) konnte man zum Beispiel studieren, wie nicht nur die begrenzte Laufzeit von 2 Jahren, sondern auch die spezifische Experimentalsituation und politische Lage Effekte auf das Verhalten der Teilnehmer*innen zeitigte (vgl. Haarmann u. a. 2009; Haarmann und Haarmann 2012). Die Dorfgemeinschaft hat nicht bloß das Geld je individuell erhalten und ausgegeben, sondern im Bewusstsein der politischen Situation Namibias, in der damals eine gewisse Aussicht darauf bestand, dass ein Erfolg der BGE-Pilotstudie eine landesweite Einführung zur Folge haben könnte, ein dörfliches Komitee gegründet, dass es sich zur Aufgabe machte, diesen Erfolg aktiv zu befördern, indem es den Mitgliedern des Dorfes bei der vernünftigen Nutzung des Geldes beratend zur Seite stand, usw. Mit solchen interessanten, kontextspezifischen Effekten muss man bei einer Experimentalstudie von vorneherein rechnen. In ihnen spiegelt sich zunächst einmal die konkrete Situation des BGE-Experiments wider, bei dem noch unsicher war, ob das BGE später dauerhaft eingeführt werden wird. Eine Wirkung wie die geschilderte kann allerdings wie im vorliegenden Fall auch etwas über die grundsätzliche Fähigkeit eines Dorfes zur kollektiven Verantwortungsübernahme aussagen und über den besonderen Kontext der Experimentalstudie hinaus aufschlussreich sein. Das muss immer konkret-interpretierend geklärt werden.
Jürgen Schupp tut jedoch bei seinem Vergleich mit der pharmazeutischen Wirkungsforschung eindeutig so, als würde die BGE-Zahlung wie ein Medikamentenwirkstoff vom ersten Tag an eine einheitliche, vom spezifischen gesellschaftlichen Erhebungskontext der Experimentalstudie isolierbare Wirkung entfalten und spielte dabei auch die Laufzeitperspektive nur noch eine quantitative, wahrscheinlichkeitstheoretische Rolle: je länger, desto sicherer die statistische Basis der Schlussfolgerungen, die jedoch im Prinzip auch schon nach drei Jahren mit einer brauchbaren Wahrscheinlichkeit Schlüsse zulassen würde. Das ist, man muss es deutlich sagen, erkenntnistheoretisch betrachtet Unsinn und verweist auf einen verdinglichten sozialwissenschaftlichen Zahlenpositivismus, wie er schon im „Positivismusstreit der deutschen Soziologie“ in den 1960er-Jahren hinlänglich kritisiert worden ist (Adorno u. a. 1988).
Die Auswertung der statistischen Forschungsbefunde verlangt ein kontextsensibles, eingehend-interpretierendes Vorgehen, dem Schupp mit der Haltung des verdinglichten Zahlenpositivismus simplifizierend ausweicht. Es ist eben mitnichten so, dass die im Zuge der Durchführung der DIW-Studie anfallenden statistischen Daten unmittelbar die eigentlich interessierende Situation eines Gemeinwesens mit dauerhaft eingeführtem BGE widerspiegeln werden, sondern eine davon stark abweichende lebenspraktische, gesellschaftliche Experimentalsituation. Man kann aus dieser künstlich erzeugten Praxiskonstellation sicherlich einiges lernen. Aber die Zahlen sprechen nicht, wie es in einem positivistischen Wissenschaftsverständnis angenommen wird, mehr oder weniger unmittelbar für sich. Sie müssen eingehend aus dem Entstehungszusammenhang heraus interpretiert, abstrahierend in allgemeine Theoriemodelle überführt und schließlich auf die eigentlich interessierende, wiederum deutlich anders gelagerte konkrete Praxiskonstellation eines Gemeinwesens mit dauerhaftem BGE schlussfolgernd übertragen werden.
Wer glaubt, diese komplexe, mühselige intellektuelle Interpretations- und Übertragungsarbeit durch das bloße Beschaffen und unmittelbare Betrachten von Zahlen umgehen zu können, hängt ganz ohne Zweifel einer Illusion an. Eine direkte Bestätigung, dass ein BGE funktioniert oder nicht, mithilfe von statistischen Daten ließe sich nur unter einer Voraussetzung erzielen: wenn ein BGE tatsächlich dauerhaft in einem Gemeinwesen eingeführt werden würde und dabei dann die entsprechenden Häufigkeitsverteilungen von Merkmalsausprägungen erhoben würden. Diese bisher unbekannte gesellschaftliche Praxis soll aber gerade vorgreifend durch Experimentalstudien, soweit es geht, wissenschaftlich ergründet werden. Das ist auch sicherlich bis zu einem gewissen Grad möglich, allerdings nur dann, wenn die vorgreifend (im Hinblick auf die Situation eines Gemeinwesens mit dauerhaftem BGE) konsultierte Empirie in ihrer Andersartigkeit methodisch konsequent respektiert, eingehend interpretiert und vermittelt über Theoriemodelle in ihrer Aussagekraft für eine mögliche Zukunft mit BGE herangezogen wird.
Vor dem Hintergrund des Ausgeführten erscheint die anfängliche, später im Hinblick auf die Größe zumindest partiell korrigierte Darstellung der DIW-Studie als große Langzeitstudie mehr als nur mutwillig-übertrieben. Sie folgt der Logik eines brachialen Selbstmarketings, das einer methoden- und erkenntniskritischen Grundhaltung, die für Wissenschaftler*innen essenziell ist und tief habitualisiert sein muss, deutlich widerspricht. Diese Logik findet sich in der anfänglichen DIW-Presseerklärung unter anderem auch im Abkanzeln bisheriger BGE-Sozialexperimente in anderen Ländern, die in ihrem Erkenntniswert im Hinblick auf Deutschland als „weitgehend unbrauchbar“ bezeichnet werden:
„‘Diese Studie ist eine Riesenchance, um die uns seit Jahren begleitende theoretische Debatte über das bedingungslose Grundeinkommen in die soziale Wirklichkeit überführen zu können. Bisherige weltweite Experimente sind für die aktuelle Debatte in Deutschland weitgehend unbrauchbar. Mit diesem lang angelegten Pilotprojekt für Deutschland betreten wir wissenschaftliches Neuland‘, sagt Jürgen Schupp, Senior Research Fellow des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) am DIW Berlin.“ >Link
Zwar ist ein BGE-Sozialexperiment mit statistischer Begleitforschung in Deutschland ein Novum. „Wissenschaftliches Neuland“ ist dies aber deswegen natürlich noch nicht. Das Zitat strotzt auch sonst vor Übertreibungen und Überhöhungen, was die Bedeutung der DIW-Experimentalstudie anbelangt. Denn auch die pauschalisierende Darstellung ist übertrieben und überzogen, dass die bisherige Debatte eine theoretische war und erst mit der DIW-Studie die soziale Wirklichkeit wissenschaftlich-empirisch in den Blick gerät.
Über die Tatsache des brachialen Selbstmarketings mag man großzügig hinwegsehen, in der Erwartung, dass sich die beteiligten Wissenschaftler*innen nach dieser marketingartig-übertriebenen Auftakt-Bekanntmachung nun vielleicht dem seriösen wissenschaftlichen Alltagsgeschäft widmen werden. Das Problem ist allerdings, dass das Zitat, wie deutlich geworden sein sollte, zugleich auf einen verdinglichten sozialwissenschaftlichen Zahlenpositivismus bei der wissenschaftlichen Studienleitung hinweist. Und dies ist auch perspektivisch schwerwiegend.
Nur aus dem Blickwinkel dieses Zahlenpositivismus erscheinen BGE-Sozialexperimente in anderen Ländern in ihrem Erkenntniswert als „weitgehend unbrauchbar“ im Hinblick auf Deutschland, weil die dortigen statistischen Daten einem deutlich anderen gesellschaftlichen Kontext entstammen. Sie können daher nicht mehr ohne Weiteres, d. h. ohne mühsame Interpretationsarbeit, der ihren differenten Entstehungszusammenhang in Rechnung stellt und Übersetzungsarbeit leistet, unmittelbar zeigen, ob ein BGE auch in Deutschland „funktioniert“.
Erhebt man wissenschaftlich einen solchen zahlenpositivistischen Anspruch, wonach die erhobenen statistischen Daten gewissermaßen intellekt-, analyse- und interpretationslos nach Möglichkeit unmittelbar für sich selbst sprechen sollen, richtet sich dieser am Ende allerdings auch gegen die angepriesene DIW-Studie selbst. Zwar findet diese Studie in Deutschland statt. Aber die in ihrem Zuge entstehenden statistischen Zahlen spiegeln eben unmittelbar erst einmal nur den konkreten Entstehungszusammenhang der auf drei Jahre begrenzten Experimentalstudie und des spezifischen gesellschaftlich-politischen Umfelds wider, nicht aber jene deutlich andersgeartete Praxiskonstellation eines deutschen Gemeinwesens, das auf Dauer ein BGE für alle Bürger*innen eingeführt hat.
Schon die Unterschiede zwischen dem deutschen Gesellschaftssystem der Gegenwart in seiner ganzen Konkretion, die sich von anderen Ländern tatsächlich vielfältig unterscheidet, und einem hypothetischen deutschen Gemeinwesen, das dauerhaft ein BGE eingeführt hat, würden sich nicht einfach nur darauf beschränken, dass ersterem das Element einer bedingungslosen Dauerzahlung für Alle hinzugefügt worden ist. Die Einführung eines BGEs impliziert sehr viel mehr. Der Grundgedanke ist zwar einfach. Aber die konkrete Umsetzung verlangt doch eine lange Liste von konkretisierenden Gestaltungsentscheidungen, die sich heute schon in den vorgeschlagenen, höchst heterogenen Grundeinkommensmodellen andeutet. Angefangen bei der Höhe der monatlichen BGE-Zahlung über die Frage nach dem unvermeidlicherweise komplexen Finanzierungsansatz, der schon für sich genommen das bisherige Verteilungssystem und Soziale Sicherungssystem auf je unterschiedliche Weise erheblich verändern würde, bis hin zur Frage, wie das BGE in das überkommene Sozialstaatsgefüge eingepasst wird, was von dem Bisherigen beibehalten werden soll, welche Sozialstaatselemente womöglich aufgegeben werden können, welche wie modifiziert werden müssen, usw. Alles Aspekte, die je unterschiedliche Folgewirkungen auch auf das Verhalten der Bürger*innen haben können. Das BGE verlangt zudem rechtliche Anpassungen, darunter zum Beispiel Überführungsregelungen, was die bisher erworbenen Rentenansprüche betrifft und vieles mehr. Man muss daher realistisch davon ausgehen, dass mit der konkreten Einführung eines BGEs Vieles im bisherigen deutschen Gesellschaftssystem auf die ein oder andere Weise eine erhebliche Modifikation erfahren würde, sodass sich ein Deutschland mit dauerhaftem BGE in vielerlei Hinsicht von dem Deutschland der Gegenwart unterscheiden würde, im Grunde genommen ein anderes Land wäre.
Ein wissenschaftlicher Zahlenpositivismus ist daher erkenntnistheoretisch betrachtet grundsätzlich auf verlorenem Posten, was die wissenschaftlichen Herausforderungen anbelangt, welche die Diskussion zum BGE aufwirft. Hat man jedoch den großen Interpretationsbedarf und die mühsame intellektuelle Arbeit des kontextsensiblen Schlussfolgerns, Abstrahierens und Übertragens auf deutlich andere Praxiskonstellationen als die jeweils empirisch vorliegende als unhintergehbar und unvermeidlich bei der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem BGE erkannt, dann erscheinen auch die Grundeinkommens-Sozialexperimente in anderen Ländern als aufschlussreich und erkenntnisträchtig, auch im Hinblick auf Deutschland. Dann sind allerdings auch noch viele andere Dinge empirisch interessant: etwa die heutige Praxis des ehrenamtlichen Engagements, die biografische Verarbeitung von Lotteriegewinnen oder frühen Dauerrenten, die ökonomisch ein auskömmliches Leben sichern und zugleich Zuverdienste durch Erwerbsarbeit zulassen, die Bedeutung von intrinsischer Motivation im Vergleich zu extrinsischen Anreizen, usw, auch historische Fragestellungen, wie sie zum Teil im Sonderforschungsbereich „Muße“ an der Freiburger Universität erforscht werden. Vor einer Fetischisierung statistischer Experimentalstudien im Bereich der Sozialwissenschaften kann man vor diesem Hintergrund nur warnen.
Positivistische „Bornierungen“ drohen dabei nicht nur vonseiten frequenzanalytischer, quantifizierender Untersuchungen, wie sie in dem schon erwähnten „Positivismusstreit der deutschen Soziologie“ in den 1960er-Jahren noch im Zentrum standen. Längst gibt es auch einen verbreiteten „qualitativen“ Positivismus, etwa bei Fallstudien, die sich vorwiegend auf die subjektiven Sichtweisen von Menschen ausrichten, diese überwiegend nur paraphrasieren, statt sie als Teilmoment einer realen Praxis zu analysieren, die weit über diese subjektive Ebene hinausreicht und in vielerlei Hinsicht auch einen eigenlogischen Charakter annimmt.
Generell lässt sich der sozialwissenschaftliche Positivismus, ob „quantifizierend“ oder „qualitativ“, daran erkennen, dass das empirisch Konstatierbare in seiner „Positivität“ vorwiegend nur paraphrasiert und somit bloß in anderer, sprachlicher bzw. zahlenmäßiger Form wiederholt, sozusagen verdoppelt wird, statt es analytisch tatsächlich aufzuschließen. Letzteres setzt zwingend voraus, dass diese positive Faktizität als eine Wirklichkeit rekonstruiert wird, die strukturell auf (selten ganz bewusste) Selektionsentscheidungen angesichts von in der Praxis gegebenen objektiven Möglichkeiten zurückgeht, wobei dann zu bestimmen ist, warum und mit welchen guten oder weniger guten subjektiven bzw. kulturellen Gründen, Dispositionen usw. diese Selektionen vorgenommen und verwirklicht worden sind.

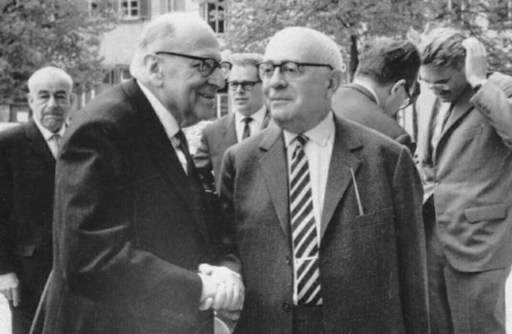
Wo in den Sozialwissenschaften bei der wissenschaftlichen Analyse der objektive Möglichkeitsraum nicht, wie es schon Max Weber, später besonders Theodor W. Adorno und dann vor allem Ulrich Oevermann mit seiner Methodologie einer Objektiven Hermeneutik eingeklagt haben (siehe Adorno 1956; Adorno u. a. 1988; Oevermann 2013, 2016; Weber 1988, siehe auch: >Link), explizit mitthematisiert wird und das ständige praktische Wechselspiel von emergierenden Möglichkeiten und daraus selegierender Verwirklichung durch einen Akteur rekonstruiert und analysiert wird, kann man auch nicht von einer erkenntnistheoretisch anspruchsvollen sozialwissenschaftlichen Forschung sprechen, die tatsächlich Erkenntnisbildung betreibt und sich nicht bloß auf ein analyseloses „Fakten“-Sammeln beschränkt. Bei letzterem droht das gesellschaftlich Bestehende grundsätzlich der Tendenz nach als Sieger hervorzugehen (Stichwort: „die normative Kraft des Faktischen“), denn das Bestehende wird nur dann fraglich, wenn man es analytisch mit einer strukturell ebenso realen Welt der objektiven Möglichkeiten konfrontiert und die operativen sinnhaften Begründungen für bisherige Selektionsentscheidungen rekonstruiert und neu zur Diskussion stellt. So gesehen birgt auch der verdinglichte Zahlenpositivismus bei der Leitung der DIW-Studie zum BGE methodisch, sicherlich ungewollt, die Gefahr, am Ende eher einer kritiklosen Bestätigung des Bestehenden zuzuarbeiten.

Der Zahlenpositivismus scheint zwar bei der DIW-Studienleitung besonders ausgeprägt zu sein. Aber er ist bei der bisherigen Grundeinkommensforschung als Tendenz alles andere als eine Ausnahme. Von Anbeginn bis heute hat er das Feld faktisch dominiert. Schon die Sozialexperimente der 1970er-Jahre in den USA und Kanada hatten eine starke positivistische Tendenz. Ein naturalistischer, damals überwiegend noch als „ethnologisch“ bezeichneter Feldzugang spielte bei ihnen keine oder nur eine vernachlässigenswerte, unsystematische Rolle am Rande. Hintergrund war unter anderem, dass die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht zuletzt unter dem Einfluss der wissenschaftstheoretischen Debatte um die „Forschungslogik“ Karl Raimund Poppers, ein Wissenschaftsverständnis ausgebildet hatten, das in mathematisch-statistischen Forschungsmethoden das Versprechen erblickte, diese Wissenschaften zu harten Erfahrungswissenschaften nach dem Vorbild der schon länger etablierten Naturwissenschaften fortentwickeln zu können. Für die Wirtschaftswissenschaften, die bei den Sozialexperimenten als Fach dominierten, galt dies im besonderen Maße. Aber auch in der Soziologie gab es schon früh ähnliche Tendenzen, wie unter anderem Buchtitel von Emile Durkheim wie „Physik der Sitten und des Rechts“ veranschaulichen mögen. Allerdings gab es bei den Wirtschaftswissenschaften auch besondere sachliche Gründe für eine größere methodische Bedeutung von Zahlen, spielen doch ebensolche im Gegenstand der „Wirtschaft“ in Form des Geldes und von Preisen eine zentrale, regulierende Rolle. Abgesehen davon haben Statistiken natürlich dort ihren besonderen Wert, wo die Erfassung aggregierter Masseneffekte als wichtig erscheint. In der Soziologie und weiteren Fächern kamen ab den 1970er-Jahren interpretative Forschungsmethoden hinzu, die das Wissenschaftsverständnis zunehmend aus der mathematisch-statistischen Verengung früherer Jahrzehnte befreiten. Diese Entwicklung ist jedoch an den Wirtschaftswissenschaften, soweit ich sehen kann, weitgehend vorbeigegangen, die bis heute die mittlerweile vorliegenden und falsifikationistischen Ansprüchen genügenden hermeneutisch-fallrekonstruktiven Forschungsmethoden nicht in ihre reguläre Hochschullehre integriert haben, obwohl man trotz der großen Rolle, die Zahlen im Gegenstand „Wirtschaft“ spielen, eindeutig sagen muss, dass auch die Wirtschaftswissenschaften in erster Linie eine Wissenschaft von der sinnstrukturierten menschlichen Lebenspraxis sind und sachlich betrachtet insofern auch nicht ohne sinnrekonstruierende, hermeneutisch-fallanalytische Methoden auskommen können.
Wie ausgeprägt der Zahlenpositivismus, nicht zuletzt unter dem Einfluss der Wirtschaftswissenschaften, bis heute in der Grundeinkommensforschung geblieben ist, zeigt die schon erwähnte Forschungspraxis der NGO givedirectly, die auf ihrer Internetseite randomisierte kontrollierte Studien unter der Überschrift „Experimental Evaluations“ generell als „Goldstandard“ der Wissenschaft feiert:
“a randomized controlled trial (RCT), considered the gold-standard for evidence” (Abgerufen am 8.9.2020, >Link)
Hier liegt eindeutig eine Fetischisierung dieser Art von Forschung vor, die den dabei zu konstatierenden Verlust an begrifflich-strukturanalytischer Erkenntnispräzision, wie er mit fallrekonstruktiven Forschungsmethoden möglich wäre, vereinseitigend auch noch zur höchsten wissenschaftlichen Tugend verklärt.
Schaut man sich bisherige BGE-Pilotstudien an, stellt man schnell fest, dass es darunter keine gibt, die fallrekonstruktive Forschungsmethoden systematisch einbezieht. Zwar werden gelegentlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit Fallporträts erstellt, weil man sich durch deren Anschaulichkeit gerade für diese Zwecke Vorteile verspricht. Oder eine irgendwie geartete „qualitative“ Forschung (eine vage Residualkategorie, die sehr heterogene Methoden unter sich versammelt, von denen nur ein kleiner Teil wirklich fallrekonstruktiv ist) läuft vielleicht auch mal für sich selbst nebenbei mit. Aber eine professionelle, fallrekonstruktive Forschung, die systematisch in die Gesamtstudie einbezogen wird, findet bis heute nicht statt. Und dies nach 50 Jahren Entwicklung und Etablierung interpretativer Forschungsmethoden in den Sozialwissenschaften und einer Entwicklung der wissenschaftstheoretischen Diskussion, welche die erheblichen Begrenzungen einer bloß auf subsumtionslogisch-voreingenommene Hypothesenüberprüfung und nicht zugleich auf unvoreingenommen-rekonstruktionslogische Hypothesengenerierung ausgerichteten Forschungslogik à la Popper schon lange umfänglich erwiesen hat.
Auch die DIW-Studie macht hier allem Anschein nach keine Ausnahme. Was in bisherigen Ankündigungen als mitlaufende Forschung diverser Kooperationspartner*innen, wie z.B. dem Psychologen Jens Nachtwei, Erwähnung gefunden hat, scheint eher einem subsumtionslogischen Vorgehen, denn einem rekonstruktionslogischen zu entsprechen.
Wie bedeutsam eine rekonstruktionslogisch-fallanalytische Methodenkomponente wäre, sollen folgende, skizzenhafte Ausführungen zum Abschluss zumindest noch andeuten. Bei der öffentlichen Diskussion zum BGE besteht bei einer dominant quantifizierenden (in der Regel subsumtionslogischen) Ausrichtung der Forschung methodisch grundsätzlich die Gefahr, dass bei entdeckten statistischen Befunden aus Mangel an Kenntnis von dahinter verborgenen neuartigen Strukturdynamiken etwas aus dem bisherigen Arsenal bekannter Prozesse hineininterpretiert wird bzw. die Befunde fälschlicherweise unter das schon Bekannte subsumiert werden. Aber auch im Hinblick auf vermeintlich bekannte Strukturdynamiken ist ohne die Existenz einer systematischen fallrekonstruktiv-strukturanalytischen Forschungspraxis zu bezweifeln, dass diese tatsächlich schon hinreichend verstanden und analytisch durchdrungen worden sind.
Statistische Korrelationen können uns auf Strukturzusammenhänge der untersuchten Praxis hinweisen, die sich in ihrer Systematik und Gesetzmäßigkeit unter anderem auch in Zahlen zeigen. Ohne einen fallrekonstruktiven Zugriff auf die Empirie, der die dahinter vermuteten Strukturzusammenhänge und ‑dynamiken der Lebenswirklichkeit mithilfe von reichhaltigen, naturalistischen Falldaten wenigstens exemplarisch nachweist, tappt die statistische Korrelationsforschung jedoch häufig im Dunkeln und lädt zum – sehr schnell vorurteilsbeladenen – Mutmaßen und zu Fehlschlüssen ein. Die fallrekonstruktive Forschung ermöglicht nicht nur für sich selbst stehend reichhaltige Strukturerkenntnisse. Sie kann angesichts des Ausgeführten auch eine wirkungsvolle Maßnahme der „Qualitätssicherung“ bei der Erkenntnisbildung einer dominant quantifizierenden Untersuchung sein. Trotz Jahrzehnte langer Diskussionen um „Qualitätskontrolle“ auch im Wissenschaftsbetrieb ist dies allerdings längst noch keine Normalität. Es wäre sicherlich auch sehr viel bedeutsamer, als die von Jürgen Schupp zitierte Praxis des Prä-Registrierens, die zudem nicht unproblematisch ist.1 Es geht bei einer fallrekonstruktiven Qualitätssicherung schlicht darum sicherzustellen, dass theoretische Modellannahmen über die menschliche Lebenswirklichkeit, seien sie ökonomischer oder anderer Art, die zur selektiven und darin methodisch auch voreingenommenen Richtschnur für quantifizierende Datenerhebungsprozeduren werden, sich mithilfe von reichhaltigen, naturalistischen Falldaten exemplarisch als realitätsangemessen erweisen lassen.
Häuft ist es nämlich so, dass bei statistisch-quantifizierenden Forschungsmethoden theoretische Modellannahmen empirisch überprüft werden, die beim Vorhandensein eines fallrekonstruktiven Einblicks in den betreffenden Gegenstandsbereich von Anfang an als unsinnig, viel zu undifferenziert und abstrakt oder die Wirklichkeit in wichtigen Momenten verzerrend usw. erscheinen, aber mit statistischen Daten allein später oft nicht mehr in dieser Unangemessenheit nachträglich identifizierbar sind. Zahlen sind häufig zu abstrakt, zu selektiv auf isolierte qualitative Merkmalsdimensionen bezogen und in ihrem Informationsgehalt zu wenig reichhaltig, um der konkreten sinnstrukturierten menschlichen Lebenswirklichkeit als Empirie die erforderlichen Chancen einzuräumen, vorurteilsbeladene theoretische Modellannahmen wirkungsvoll zu Fall zu bringen. Es wäre daher viel gewonnen, wenn Forscher*innen, die bestimmte theoretische Modelle quantifizierend mit der Empirie konfrontieren möchten und dafür in erheblichem Maße Geld einsetzen, mit einigen Fallrekonstruktionen zunächst einmal exemplarisch nachweisen würden, dass es überhaupt Fälle gibt, die durch die Einzelheiten der leitenden theoretischen Modellierung konsistent, angemessen und gestaltrichtig repräsentiert werden.
Nicht wenige meiner Kolleginnen und Kollegen in der fallrekonstruktiven Forschungspraxis haben sich mit mir zusammen zum Beispiel oft darüber gewundert, wie in der Öffentlichkeit zur Hoch-Zeit der Agenda 2010 über angebliche „Sozialschmarotzer“-Fälle gesprochen wurde, welche theoretischen Modellannahmen dabei im Detail zumindest implizit gemacht wurden, die nicht wenige Arbeitsmarktökonom*innen in einem stark materialistisch gefärbten, anreiztheoretischen Weltbild ernstnahmen. In Fernsehtalkshows wurden solche Fälle regelmäßig der Öffentlichkeit vorgeführt und zur Bestätigung der Richtigkeit des von Gerhard Schröder nach seiner Wiederwahl zum Auftakt der Ankündigung der Agenda 2010 mit einem Bildzeitungs-Interview angezettelten „Faulenzerdebatte“ herangezogen. Einer dieser vorgeführten, vermeintlichen Sozialschmarotzer war Arno Dübel, der in seinen öffentlichen Äußerungen bekundete, sich mit dem Arbeitslosengeld ein schönes Leben zu machen und in keinster Weise an Erwerbsarbeit interessiert zu sein, die ihm viel zu mühselig sei; er bekäme das nötige Geld ja auch schon viele Jahrzehnte so vom Staat. >Link – >Link
Solche in Fernsehtalkshows bereitwillig zur Rechtfertigung der Notwendigkeit eines aktivierenden „Fördern und Forderns“ herangezogene Selbstpräsentationen von vermeintlich skrupellosen Sozialmissbrauchsfällen wurden unumwunden, ohne jeden leisen Zweifel bereitwilligst akzeptiert, obwohl zum Beispiel im Falle von Arno Dübel schon dessen Erscheinungsbild ernsthafte Zweifel an der Authentizität dieser Selbstpräsentation wecken musste, der zufolge man es bei seiner Person mit jemandem zu tun habe, der es sich ohne jeden Anflug von Skrupel auf Staatskosten gut gehen lässt, dem es redlich empfunden gut geht, der sein Leben aufrichtig trotz des selbst deklarierten Arbeitslosengeldmissbrauchs als glücklich und zufrieden erlebt. Arno Dübel ist nämlich unübersehbar und unüberhörbar ein schwerer, gesundheitlich angeschlagener Raucher mit einer Stimme wie ein Ofenrohr und Tränensäcke, die fast bis zur Nasenspitze herabreichen, usw. Angesichts dessen musste man schon seine Wahrnehmungssinne auf der Suche nach Vorurteils- u. Ressentimentbestätigung entschlossen verstopft haben bzw. für den elementarsten Erkenntnismodus überhaupt, dem ästhetischen, unempfänglich sein, um nicht Zweifel an Arno Dübels Selbstpräsentation zu bekommen, dass es ihm wirklich gut geht, er es sich wirklich gut gehen lässt, er bei dem zur Schau gestellten Sozialmissbrauch wirklich keinerlei Skrupel verspürt und er sich sein langzeitarbeitsloses Lebensschicksal tatsächlich so selbstbestimmt ausgewählt hat, wie er es in seinen Äußerungen zur Empörung des gesellschaftlichen Spießertums nahelegt.
Besonders aber auch die (uns) zur Verfügung stehende fallrekonstruktive Forschungserfahrung weckt daran große Zweifel. Bei ähnlichen Fällen war es bei eingehender Analyse der reichhaltigen naturalistischen Falldaten durchgängig so, dass sich eine solche Selbstpräsentation bei näherer Betrachtung als Maskerade entpuppte, hinter der die blanke Verzweiflung oder Vergleichbares stand. Nie konnten wir Fälle finden, die dem öffentlich erzeugten Bild des skrupellos-egoistischen Sozialtransfertaktikers tatsächlich entsprachen, wie es eben zum Teil auch in der Arbeitsmarktforschung bekräftigt worden ist (vgl. hierzu Gebauer u. a. 2002).
Nun können wir nicht wissen, ob sich solche Fälle nicht doch irgendwo finden lassen. Das muss offen bleiben. Was wir allerdings wissen, ist, dass die quantifizierende Arbeitsmarktforschung, die solchen theoretischen Konstruktionen nachgelaufen ist, die Existenz solcher Fälle nicht schlüssig mithilfe von naturalistischen Falldaten und stimmigen Fallrekonstruktionen nachgewiesen hat. Der Verweis auf entsprechende Selbstpräsentationen und subjektive Selbstsichten reicht dazu jedenfalls nicht aus, zumal man nicht nur anderen Menschen etwas vormachen kann, sondern sich auch über sich selbst und die Realitäten des eigenen Lebens gewaltig täuschen kann.
Gerade für die Grundeinkommensforschung wäre eine fallrekonstruktive Forschungskomponente von großem Wert, wimmelt es in den entsprechenden Debatten auf der Seite der Kritiker*innen doch nur so an wilden, abschätzigen Unterstellungen über die angeblich durch und durch materialistisch-anreizgetriebene, egoistisch-unvernünftige Natur von (in der Regel anderen) Menschen. Um aber die je konkrete Vernünftigkeit oder Unvernunft einer individuellen Praxis tatsächlich erkennen und nachweisen zu können, muss man sie auch je konkret und unvoreingenommen naturalistisch in ihrer lebensgeschichtlichen und situativen Besonderheit betrachten, also rekonstruktionslogisch.
Fußnoten:
1. Bisherige Qualitätskontrollen haben bezeichnenderweise meist einen bürokratischen Charakter. Sie entfalten dann nicht selten eine destruktive, deprofessionalisierende Wirkung auf die professionalisierungsbedürftige Berufspraxis. Auch das Prä-Registrieren kann in dieser Hinsicht problematische Konsequenzen zeitigen, sofern es zur (standardisierten) Erfolgskontrolle von Forschungsvorhaben, eben nach dem Maßstab vorab registrierter Zielsetzungen und Leithypothesen dient. Denn der Erfolg eines Forschungsvorhabens bemisst sich eben keineswegs daran, ob anfängliche Zielsetzungen erreicht worden sind und Leithypothesen bestätigt werden konnten, sondern sachlich betrachtet vor allem daran, ob die Ergebnisse in irgendeiner Weise etwas Aufschlussreiches zutage gefördert haben, auch wenn dies überraschend geschieht und in den ursprünglichen Hypothesen und Zielsetzungen nicht antizipiert worden ist.
Erwähnte Literatur:
Adorno, Theodor W. (1956): „Soziologie und empirische Sozialforschung“. In: Adorno, Theodor W.; Horkheimer, Max (Hrsg.) Soziologische Exkurse. Nach Vorträgen und Diskussionen. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt.
Adorno, Theodor W.; Dahrendorf, Ralf; Pilot, Harald; u. a. (1988): Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. Frankfurt am Main: Luchterhand (Sammlung Luchterhand 72).
Bohmeyer, Michael; Cornelsen, Claudia (2020): Was würdest Du tun? Wie uns das Bedingungslose Grundeinkommen verändert – Antworten aus der Praxis. Berlin: Econ.
Franzmann, Manuel (2010): „Einleitung. Kulturelle Abwehrformationen gegen die »Krise der Arbeitsgesellschaft« und ihre Lösung: Die Demokratisierung der geistesaristokratischen Muße“. In: Franzmann, Manuel (Hrsg.) Bedingungsloses Grundeinkommen als Antwort auf die Krise der Arbeitsgesellschaft. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft S. 11–103.
Gebauer, Ronald; Petschauer, Hanna; Vobruba, Georg (2002): Wer sitzt in der Armutsfalle? Selbstbehauptung zwischen Sozialhilfe und Arbeitsmarkt. Berlin: Edition Sigma (Forschung aus der Hans Böckler Stiftung 40).
Haarmann, Claudia; BIG Coalition (Namibia); Evangelical Lutheran Church in the Republic of Namibia; u. a. (Hrsg.) (2009): Making the Difference! The Big in Namibia: Basic Income Grant Pilot Project Assessment Report, April 2009. Windhoek, Namibia: NANGOF.
Haarmann, Claudia; Haarmann, Dirk (2012): „Namibia: Seeing the sun rise—The realities and hopes of the Basic Income Grant pilot project“. In: Murray, Matthew; Pateman, Carole (Hrsg.) Basic Income Worldwide. Horizons of Reform. London: Palgrave Macmillan UK S. 33–58.
Oevermann, Ulrich (2016): „„Krise und Routine“ als analytisches Paradigma in den Sozialwissenschaften“. In: Becker-Lenz, Roland; Franzmann, Andreas; Jansen, Axel; u. a. (Hrsg.) Die Methodenschule der Objektiven Hermeneutik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften S. 43–114, doi: 10.1007/978-3-658-00768-3_2.
Oevermann, Ulrich (2013): „Objektive Hermeneutik als Methodologie der Erfahrungswissenschaften von der sinnstrukturierten Welt“. In: Langer, Phil C.; Kühner, Angela; Schweder, Panja (Hrsg.) Reflexive Wissensproduktion. Wiesbaden: Springer VS (Frankfurter Beiträge zur Soziologie und Sozialpsychologie), S. 69–98.
Steensland, Brian (2009): The Failed Welfare Revolution: America’s Struggle over Guaranteed Income Policy. Princeton University Press.
Weber, Max (1988): „II. Objektive Möglichkeit und adäquate Verursachung in der historischen Kausalbetrachtung.“. In: Winckelmann, Johannes (Hrsg.) Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen: J. C. B. Mohr S. 266–290.
Widerquist, Karl (2018): A Critical Analysis of Basic Income Experiments for Researchers, Policymakers, and Citizens. Cham, Schweiz: Palgrave Macmillan (Exploring the Basic Income Guarantee).
Veröffentlichungen zum Thema:
- BibTeXEndNoteDOIBibSonomy(2023): „Das bedingungslose Grundeinkommen als Demokratisierung der sozialstrukturellen Verfügbarkeit von (bildender) Muße“. In: Berliner Theologische Zeitschrift. Berlin: De Gruyter pp. 47–61, doi: https://doi.org/10.1515/9783110987935-005 (Hefttitel: Bedingungsloses Grundeinkommen – Utopie, Ideologie, ethisch begründbares Ziel? XXIX. Hrsg. v. Meireis, Torsten; Wustmans, Clemens. Werner-Reihlen-Vorlesungen)
- AbstractURLBibTeXEndNoteBibSonomy(2021): „Der beschleunigte gesellschaftliche Strukturwandel als Herausforderung für Bildung und biografische Transformationen (Vorlesung 2).“. Kiel: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Retrieved am from https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:8:3-2021-00308-5 22 Seiten
- BibTeXEndNoteDOIBibSonomyDownload(2018): „Democratization of the individual availability of “leisure” through the introduction of an Unconditional Basic Income in times of accelerating societal change (with reference to the perspective of social policy research and social work)“. In: doi: 10.13140/RG.2.2.29476.12168/1 Paper presented at the Basic Income Korea Network (BIKN) Workshop “Social Policy and Basic Income: Cases of Germany and Korea", Friday, 5th October, 2018, Seoul NPO Center, 6 Seiten
- AbstractURLBibTeXEndNoteBibSonomyDownload(2017): „Zum Schicksal der ’Arbeitsethik’ in der Gegenwart und in einer möglichen Zukunft mit bedingungslosem Grundeinkommen. Soziologische Thesen mit Bezug auf Max Weber. (Arbeitspapier)“. Siegen: Universität Siegen Retrieved am from https://nbn-resolving.org/urn%3Anbn%3Ade%3Ahbz%3A467-11169 26 Seiten. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:467-11169
- URLBibTeXEndNoteBibSonomyDownload(2015): „Zur Theorie des Zusammenhangs von existenzieller Sicherheit und Säkularisierung bei Pippa Norris und Ronald Inglehart. Anmerkungen aus Sicht einer fallanalytischen Säkularisierungsforschung“. In: Lessenich, Stephan (ed.) Verhandlungen der Kongresse der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Band 37. pp. 674–681
- URLBibTeXEndNoteBibSonomyDownload(2010): „Die Krankenversicherungsprämie im ’Bürgergeld’-Konzept von Dieter Althaus. Zur Frage der Kombination des bedingungslosen Grundeinkommens mit anderen Reformelementen“. In: Franzmann, Manuel (ed.) Bedingungsloses Grundeinkommen als Antwort auf die Krise der Arbeitsgesellschaft. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft pp. 360–368
- URLBibTeXEndNoteBibSonomyDownload(2010): „Die ’Krise der Arbeitsgesellschaft’ in Interviews mit Adoleszenten. Welche Auswirkungen hätte ein bedingungsloses Grundeinkommen auf ihr Leben?“. In: Franzmann, Manuel (ed.) Bedingungsloses Grundeinkommen als Antwort auf die Krise der Arbeitsgesellschaft. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft pp. 167–196
- URLBibTeXEndNoteBibSonomyDownload(2010): „Einleitung. Kulturelle Abwehrformationen gegen die ’Krise der Arbeitsgesellschaft’ und ihre Lösung: Die Demokratisierung der geistesaristokratischen Muße“. In: Franzmann, Manuel (ed.) Bedingungsloses Grundeinkommen als Antwort auf die Krise der Arbeitsgesellschaft. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft pp. 11–103
- URLBibTeXEndNoteBibSonomy(2009): „Die Krankenversicherungsprämie im „Bürgergeld“-Konzept von Dieter Althaus und die Frage der Kombination des bedingungslosen Grundeinkommens mit anderen Reformelementen“. Frankfurt am Main: SSOAR Retrieved am from http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-56340 8 Seiten
- AbstractURLBibTeXEndNoteBibSonomy(2009): Bedingungsloses Grundeinkommen als Antwort auf die Krise der Arbeitsgesellschaft. Diskussion über Chancen, Risiken und Folgeprobleme. Öffentliche Podiumsdiskussion zwischen Ulrich Oevermann, Philippe Van Parijs, Georg Vobruba und Götz W. Werner an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main am 14. Juli 2006. Frankfurt am Main: Goethe-Universität
- URLBibTeXEndNoteBibSonomyDownload(2008): „Why people would not stop contributing if an unconditional basic income were introduced. An argumentation from within the Sociology of Religion“. Frankfurt am Main: Goethe-Universität Retrieved am from http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/5686 6 Seiten
- URLBibTeXEndNoteBibSonomyDownload(2007): „Ist die traditionelle Leistungsethik in den führenden Industrienationen zum Haupthindernis eines prosperierenden und gerechten Kapitalismus geworden? Die Relevanz dieser zeitdiagnostischen Frage für die Religionssoziologie“. Frankfurt am Main: Goethe-Universität Retrieved am from http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/1740 13 Seiten
- URLBibTeXEndNoteBibSonomyDownload(2004): „Was spricht für die Einführung eines bedingungslos gezahlten, ausreichenden Grundeinkommens?“. Frankfurt am Main Vortrag auf dem 2. Treffen des Netzwerk Grundeinkommen im Workshop „Bedingungsloses Grundeinkommen?“ im Rahmen der Konferenz „Zukunft der Gerechtigkeit“ der Heinrich Böll-Stiftung, Berlin, 11.-12. Dezember 2004, 23 Seiten
- URLBibTeXEndNoteBibSonomyDownload(2003): „Einleitung zur Ad-hoc-Gruppe: ’Die Krise der Erwerbsarbeitsethik und der Vorschlag eines bedingungslosen Grundeinkommens für alle Staatsbürger - Implikationen für die Autonomie der Lebenspraxis’“. In: Allmendinger, Jutta (ed.) Entstaatlichung und soziale Sicherheit. Verhandlungen des 31. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Leipzig 2002. Beiträge aus Arbeitsgruppen, Sektionssitzungen und den Ad-hoc-Gruppen (CD-ROM). Opladen: Leske+Budrich 9 Seiten
- URLBibTeXEndNoteBibSonomyDownload(2000): „Saving citizenship from the workhouse. Why upholding the obligation to work undermines the citizen’s autonomy“. Paper presented at the biannual BIEN-Conference 2000, Berlin, October 6/7, Working Group C: "Citizenship rights, responsibility, and paternalism"